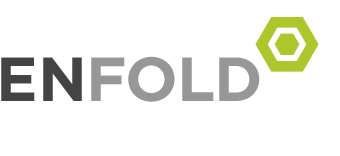.
Die selektive Jagd auf Rehwild
.
Abschussplan- Erfüllung und selektiver Abschuss beim Rehwild, das ist so ´ne Sache. Wenn beides in Kombination funktioniert, ist das eine ordentliche Angelegenheit. Nur ist das meiner Erfahrung nach meistens nicht so. Sonst wäre die Situation nicht so, wie sie ist. 30 % Fallwild, jedes Jahr, das zu fast 100 % Straßenverkehrsopfer. Und die, die in den Büschen verdämmern, die erscheinen in keiner Statistik; denn bevor wir sie finden, haben Sau und Fuchs sie längst weggeräumt. Es ist aber sehr zu befürchten, dass sie eine nicht unbedeutende statistische Größe wären. Zumindest in nicht wenigen Revieren, die ich kenne, dort nämlich, wo mit schöner Regelmäßigkeit Jährlingsböcke geschossen werden, die z. T. deutlich unter 10 Kg aufgebrochen wiegen (letzter Fall, vor einigen Tagen, 7 Kg), von verdreckten Spiegeln usw. will ich hier erst gar nicht reden.
Schmalrehe dieser Klasse erscheinen nirgends, obwohl es sie sicher in ähnlicher Relation gibt. Zwar setzen Ricken in überhöhten Beständen wesentlich mehr Bockkitze als Töchter, aber sie stellen die Produktion weiblicher Kitze natürlich nicht ein. Die sind aber deutlich nicht so viel unterwegs, wahrscheinlich, weil die Ricken in ihrem Territorialverhalten nicht so aggressiv sind wie die Böcke. Sie sterben, darf man annehmen, zu fast 100 % stiekum und unbemerkt. Und trotzdem wird von Jungjägern, von Jagdaufsehern verlangt, beim Abschuss vorsichtig zu sein! Man fragt sich sofort: Vorsichtig im Hinblick auf was??
Wir haben den Auftrag, für einen angepassten Wildbestand zu sorgen. Wir haben speziell beim Rehwild keinen Auftrag, unsere Rehe „aufzuarten“ oder zu selektieren bzw. über Selektion „aufzuarten“ (Die Vorstellung ist meines Erachtens das Einzige, das von der braunen Ideologie Eingang gefunden hat ins Jagdwesen; dafür ist sie umso zählebiger). Dabei geht das nicht nur nicht, sondern ist darüber hinaus völlig sinnlos. Ich geh´ mal näher darauf ein.
.
Die Chromosomen
Jedes Lebewesen, also auch jedes Reh, ist mit Erbanlagen ausgestattet. Wir nennen das Gene, ich sag´ manchmal salopp „es auf den Chromosomen“ haben. Die Erbanlagen übernimmt es von Mutter und Vater, die von ihren Müttern und Vätern. Im Erbgut, in den Genen ist der Genotyp jeder Kreatur festgelegt. Wieder salopp ausgedrückt ist das die Botschaft: Das kann aus Dir werden, wenn alles stimmt und Du´s richtig machst. Mach´ was draus! Also so was wie eine Betriebsanleitung für das einzelne Stück. Gerade beim Rehwild übrigens ist diese Ausstattung im Vergleich zu anderen Arten auf eine besonders breite Basis gestellt, ist damit besonders variationsfähig und robust, störunanfällig.
.
Genotyp und Phänotyp
Normalerweise läuft das so ab: Eine starke, im Sozialgefüge hochstehende Ricke, beschlagen von einem starken Bock, bringt in der Regel wieder starke, gesunde, durchsetzungsfähige Kitze, egal ob Bock oder Geiß. Normalerweise. Denn nun kann es passieren, dass zwar die Voraussetzungen alle gegeben, aber ganz einfach die Umstände nicht so sind: Es gibt einen zu hohen Rehwildbestand, dann einen Hungerwinter, auch die starke Ricke darbt während der Fötenentwicklung; ein zu kaltes Frühjahr lässt ausgerechnet zur Setzzeit die Vegetation und damit Äsung und Milchproduktion hinterherhinken, äußerliche Verhältnisse lassen zu wünschen übrig wie z. B. andauernde starke Unruhe im Revier.
Das führt dazu, dass das gesetzte Kitz körperliche Entwicklungsdefizite hat: Es bekommt einfach zu wenig Nahrung, es steht unter Dauerstress, weil es den Stress der Mutter, auch schon vor der Geburt, mitbekommt, die wiederum nach der Geburt natürlich alles tut, die Situation zu ändern, mit all der Hektik usw. usw. Folge: Das diesjährige Kitz ist ein Mickerling, klein, untergewichtig und auch ängstlich– vorsichtig. Das Kitz ist also trotz der besten genotypischen Anlagen, des genetischen Erbes der Eltern, vom Phänotyp her, also in der tatsächlichen körperlichen Ausprägung, ein schwaches Stück. 1)
Schreiben wir dieses Szenario jetzt an einem konkreten Beispiel an den Böcken eines Reviers fort: Die starken alten Böcke stehen natürlich nach wie vor in ihren Revieren. Das oder die Hungerjahre haben sie überlebt. Sie dominieren ihr Territorium – und dulden zwar ihren eigenen schwachen Bock- Nachwuchs, halten sie aber unter rigoroser Kontrolle und unterdrücken sie. Dieser Nachwuchs ist daher für den Jäger kaum zu sehen, sie trauen sich einfach nicht raus; aber sie sind da, und nicht wenige.
Der selektiv jagende Jäger nun sieht bei fast jedem Ansitz den „Alten vom Berge“ – und schont ihn, obwohl er längst über fünf ist und eigentlich seinen Reproduktionsauftrag für die Spezies lange schon erledigt hat. „Viel zu schade, lass´ uns erstmal die Schwachen, die Knopfer suchen. Der Alte soll sich vererben.“ Aber, wie gesagt, die Schwachen sieht man so gut wie nie, obwohl man weiß, sie sind da. Man sieht sie mal für ein paar Sekunden, zufällig. Aber längerfristig aus der Deckung wagen die sich einfach nicht. Und so laufen wir unserem Abschuss hinterher.
.
Manchmal hilft der Zufall
Dann rennt einer der Alten im nächsten Winter vors Auto. Und wir wundern uns, was wir im Frühjahr drauf in seinem alten Einstandsgebiet auf einmal an Böcken sehen. Schwache zwar, aber jetzt sind sie da. Sie trauen sich wieder, der Druck vom Alten ist weg. Einer, der Fitteste oder Frechste, übernimmt sein Territorium, ist aber rein körperlich nicht in der Lage, den gleichen rigorosen Druck aufzubauen, den der Alte gemacht hat. Und so beschlagen er und auch der eine oder andere Nebenbock nun als vermeintlich „schwach veranlagte“ Böcke ebenso „schwach veranlagte“ Schmalrehe und Ricken.
Der nächste Winter und das nächste Frühjahr nun sind von Segen: Der Bestand wurde in den Wintern vorher deutlich reduziert, heuer gibt es wenig Schnee, kaum Frost, reichlich Äsung, eventuell eine Mast, keine Holzarbeiten und keine Unruhe im Revier, das Wetter spielt mit. Und die schwachen Schmalrehe bzw. Ricken setzen jetzt auf einmal starke Kitze, die sich darüber hinaus noch überaus erfreulich entwickeln, und zwar auch phänotypisch, sprich vom individuellen körperlichen Erscheinungsbild her. Das heißt, der Phänotyp des starken Kitzes ist jetzt wieder in Übereinstimmung mit seinem ererbten Genotyp, den Erbanlagen, wie es noch bei Großmutter und Großvater der Fall war. Der Jäger, völlig baff, schreibt es stolz seinen „Hegebemühungen“ zu.
.
Die „Hege“
Das Rehwild kämpft sich also manchmal t r o t z nicht mehr zeitgemäßer Jagdmethoden wieder in den natürlichen Zustand zurück. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass entweder Natur und Wetter helfen. Oder die alten Fehler werden abgestellt, die vielfach praktizierte „unbedingt nötige“ Hege- Vollschonung hört auf und es wird so in den Bestand eingegriffen, dass wieder die natürlich tragbare Wilddichte im Revier herrscht. Denn sonst haben wir einen hoch wirksamen, immer wieder völlig unterschätzten Einflussfaktor im Spiel, der das Rehwild daran hindert, sein genotypisches Potential auszuschöpfen: Den sozialen Stress. Um es klar zu machen: Hermann Ellenberg hat in seinem Feldversuch in Stammham nachgewiesen, dass Rehe selbst in drangvoller Enge gut leben können, so lange nämlich, wie sie ausreichend und „ad libitum“, wie er das nannte, Nahrung und Deckung haben. Dann nämlich kommt so ein Stück auch mit einer Fläche von 50 x 50 Metern als homerange aus. In der realen Welt aber gibt es das nicht, beides zusammen. Wenn es zu viele Rehe gibt, wird gewandert, erst recht natürlich, wenn es dazu noch zu Nahrungskonkurrenz kommt. Selbst zu Normalzeiten reicht aber schon das zu enge „Aufeinanderhocken“ bei unseren territorial lebenden Rehen. Allein damit schon entsteht Aggression, kommt dazu noch Nahrungsknappheit, desto mehr: Damit entsteht sozialer Stress, in der Folge ein verhängnisvoller, sich selbst verstärkender Kreislauf.
Das ist das, was alle, buchstäblich alle Rehwild- Fachleute seit vielen Jahren immer und immer wieder predigen. Kurt, Stubbe, Osgyan, Hespeler, Ellenberg, v. Bayern u. v. a. m. Jeder, buchstäblich jeder schreibt genau das immer wieder. Und belegt es bestens, mit den unbezweifelbaren Ergebnissen langjähriger wissenschaftlicher Feldversuche. Unvergessen der Ausspruch A. von Bayerns („Über Rehe“) auf die Frage, welche Jährlinge und Schmalrehe man zu Beginn der Jagdzeit denn schießen sollte: „Vor allem genug! Und selbst dann sind noch genug da.“ 2)
Aber Hein Überhegejäger sagt: „Ich weiß das alles viel, viel besser als die Sesselfurzer!“, macht unbeirrt- verbissen im alten Trott weiter und, was das Ganze sehr viel schlimmer macht, impft das ganze wirre Getue seinen Jungjägern ein. Und wie wir alle wissen, hat nichts ein so zähes Eigenleben wie jägergenerationenlang kolportierter Unsinn. Um es mal ein wenig provokant zu sagen: Ein von ignoranten alten Böcken in seiner Prägungsphase gründlich versauter Jungjäger bleibt meist bis zu seinem Jägerlebensende ein ignoranter, gründlich versauter Überhegejäger.
.
Natürliche Auslese
Eine Art der Auslese geschieht jeden Tag, sie ist von der Natur vorgesehen und funktioniert todsicher: Tiere, die z. B. wegen eines nicht intakten Immunsystems (negative Genmutation) krank sind oder werden, leben nicht sehr lange. Entweder sterben sie oder sie werden, krank, sehr schnell Beute von Beutegreifern, auch von solchen, die sonst nicht zum Zuge kämen – bei uns Fuchs und Sau. Das Gleiche trifft für Stücke zu, deren Immunsystem den vielen Krankheiten und Infektionen nicht mehr gewachsen ist, die z. B. auf Grund überhöhter Populationsdichten in den Beständen grassieren. Mit ihnen geschieht dasselbe. Vor allem haben sie so gut wie keine Chancen, sich zu vererben – die Böcke (beim Rehwild) kommen nicht zum Beschlag, die innerartliche Konkurrenz , vulgo die gesunden, starken Böcke verhindern das; kümmernde Ricken und Schmalrehe nehmen nicht auf bzw. ovulieren erst gar nicht. Das System funktioniert also so, wie man sich die natürliche Auslese üblicherweise vorstellt.
.
Kann Jagd, können Jäger gezielt selektieren?
Gute Frage. Klare Antwort: Nein! (Und das gilt für alle Jäger, ob menschlich, ob tierisch!) Jedenfalls nicht per se, und ganz sicher nicht in dem beschränkten Rahmen und Wirkungsgefüge, die wir in unserem zeitlich begrenzten Jägerleben überblicken können. Wir sollten lernen, zwei Begriffe sorgfältig auseinanderzuhalten: Selektion und Bestandsentwicklung. Selektion erfolgt innerartlich, siehe oben, also über die Vermehrung und Vererbung, und sie geschieht in der Weise, dass sich die durchsetzungsstärksten Eltern in den Vordergrund spielen. Die Jagd schafft dazu nur die Voraussetzungen, und zwar, indem sie den Bestand auf einem dem Umfeld, den Kapazitäten angepassten Niveau hält. In einem Habitat mit angepasstem Bestand gibt es starke Individuen, die die nötige Kraft haben, sich gegen innerartliche Konkurrenten durchzusetzen. Das ist dann das, was wir Selektion nennen. Und wohin die führt, selbst das lässt die Natur sich offen. Manchmal sogar in Sackgassen.
In einem Habitat jedoch, das völlig überbesetzt ist, greift diese Gesetzmäßigkeit nicht mehr, der Beschlag wird zum reinen Zufall. D. h., auch tatsächlich genetisch schwache Individuen, vor allem schwache Rehböcke, haben weit größere Chancen, sich zu vererben, weil die wenigen starken Böcke einfach „überbeschäftigt“ sind. Die Folge sind eben, wie die Kollegen von der Anglerseite das nennen, „verbuttete Bestände“.
Sicher, der Wolf erbeutet als Hetzjäger ganz bestimmt mehr körperlich schwache als starke, ausdauernde Karibus, und wählt er sein Opfer aus einer Gruppe, einem Rudel, einer Rotte, konzentriert sich der Angriff sehr schnell auf das schwächste bzw. das langsamste Stück. 3) Aber nicht, weil der Wolf „weidgerecht“ jagt oder „selektieren“ will. Sondern weil es schlicht am bequemsten für ihn ist, weil er streng ökonomisch jagt – je günstiger das Verhältnis von Einsatz zu Ertrag, desto besser. Vor allem aber konzentriert er sich auf den Nachwuchs, denn von der körperlichen Leistungsfähigkeit und Erfahrung her fallen die automatisch in die Kategorie „schwach“, auch das stärkste von ihnen.
Aber glaubt auch nur ein vernünftiger Mensch, ein Wolf, ein Wolfsrudel würde seinen Angriff auf ein territorial, also einzeln lebendes Stück Rehwild unterlassen oder abbrechen, weil es sich um ein starkes und gesundes Stück handelt, und einen Einstand weiter ziehen, um ein schwaches Stück zu suchen?
Das ist ja wohl eine rein rhetorische Frage. Will sagen: Wenn mal ein starkes Reh vor dem schwachen stirbt, ist das keine Katastrophe, denn das passiert millionenfach. Das Ergebnis ist über kurz oder lang das Gleiche: Eine Reduzierung des Bestandes, die Voraussetzung dafür, dass sich die Stärkeren beim Reproduktionsgeschehen überhaupt flächendeckend in den Vordergrund schieben können. Aber der Spezies schadet es nicht, wenn zunächst und vereinzelt ein schwächeres Stück nachrückt. Siehe Genetik.
Und beim allseits bewunderten eleganten Schleicher, dem Luchs, ist diese Tücke geradezu Methode. Als fast reiner Lauer- und Überraschungsjäger nimmt er das, was gerade seinen Weg kreuzt und unvorsichtig ist. Und selbst das stärkste und fitteste Reh, das da in seinem Revier geht, hat nun mal ab und an seine dumme Stunde. Sors mala, nihil aliud.
Manche Jagdmenschen aber, leider noch viel zu viele, meinen immer noch, sie könnten das besser als Mutter Natur, vor allem verschließen sie die Augen vor ihren uralten, bewährten Regelkreisen und deren Wirkungsweisen.
.
Auslese durch Jagd?
Ich weiß nicht mehr, wer von den oben zitierten Autoren es war, einer davon war es jedenfalls, der, ich zitiere aus dem Gedächtnis, sinngemäß gesagt hat: „Die Spezies Capreolus capreolus existiert seit ca. 25 Mio Jahren und hat alle widrigen Umstände in dieser langen, langen Zeit ohne jeden Schaden und als Art enorm widerstandsfähig und gesund überlebt (siehe weiter oben, Variationsbreite im Erbgut). Jetzt kommen wir und meinen, wir könnten es mit neuen Ideen und Moden besser machen. Das Ergebnis wird nicht gesunderes Rehwild sein – gesunder als gesund geht per se nicht -, das Ergebnis ist eine endlose Debatte und Schwadronieren auf Kosten der Rehe.“
Man kann Rehwild einfach nicht selektiv bejagen, jedenfalls nicht so, wie viele meinen, das zu können, also indem man über die gezielte Entnahme „genetisch minderwertiger Stücke“ den Genpool der Spezies Capreolus capreolus verbessert. Dazu müsste man nämlich in der Lage sein, die „genetisch minderwertigen“ Stücke per Fernanalyse zu erkennen. Und selbst wenn das ginge, was würde das heißen?
Sicher gibt es bei Einzelstücken, Individuen Genveränderungen, die bekannten Mutationen. Die muss es geben, weil die nämlich das einzige Werkzeug der Natur zur stammesgeschichtlichen Weiterentwicklung, Darwins Evolution, sind. Die Natur versucht es eben nach dem Grundsatz „trial and errror“. Was sich nicht durchsetzt, verschwindet halt wieder. Nur: Wie soll ich die erkennen? Was ja die Voraussetzung wäre, um sie gezielt wieder „auszumerzen“. Ich meine, Genveränderungen, Mutationen stehen ja nicht außen an die Decke oder Schwarte geschrieben, noch nicht mal beim Zuchtvieh. Also: Wieder so eine rhetorische Frage.
Aber gehen wir mal, rein hypothetisch, weiter und unterstellen wir mal, es wäre irgendwann mal möglich, solche Mutationen zu erkennen. Sofort hätten wir das nächste Problem: Ist das nun eine negative oder positive Mutation? Anders ausgedrückt: Ist es eine evolutionäre Sackgasse oder eine erfolgreiche Adaption an veränderte Umweltbedingungen? Um das wiederum beurteilen zu können, müssten wir in der Lage sein, das Chaos- System „Umwelt“ zu verstehen. Schwierig? Nein, unmöglich. Das schaffen wir bisher trotz Super- Computern ja noch nicht mal beim Wetter, das ja bekanntlich nur einer der vielen Faktoren ist, die unsere Umwelt definieren. Und gerade das Merkmal „geringere körperliche Ausstattung“, bei der überkommenen Hegejagd bekanntlich d a s klassische Selektions- Kriterium, ist ja eben nicht auf eine Erbgut- „Verschlechterung“ zurückzuführen, wie wir gesehen haben.
Was das Ganze jetzt noch chaotischer macht: Die veränderten Umweltbedingungen, an die das Stück, seine Nachkommen sich eben adaptiert haben, haben die Bestand? Oder pendelt die Natur nach einer gewissen Zeit wieder in den alten Zustand zurück? Wenn ja, erweist sich die eben noch erfolgreiche Adaption auf einmal als evolutionärer Nachteil.
Machen wir´s kurz: Das unterscheiden zu wollen, damit hält sich noch nicht mal die Natur auf. Sie wartet einfach ungerührt das Ergebnis ab, vor allem das große und ganze Ergebnis. Einzelschicksale interessieren sie nicht, Ausreißer gibt es überall.
.
Altbewährtes kopieren – was ist daran verkehrt?
Wir sollten es einfach so machen wie die Natur: So jagen wie sie vorgeht. Wenn wir Rehe sehen und wir „kommen dran“, dann schießen wir. Meine Devise war und ist, und danach wurde und wird bei mir Rehwild bejagt:
Man muss sie schießen, wenn man sie sieht: Zu 90 % sieht man sie kein zweites Mal!
Um hier dem reflexartigen Vorwurf der Ausrottung und des Schießertums zu entgegnen: Es ist überhaupt nicht schädlich, wenn man mal ein ganz besonders vitales, starkes, junges Stück nicht schießt; das gehört schließlich auch zur Freude an der Jagd, am Wild, am Revier. Aber das sollte eher die Ausnahme statt die unbedingte Regel sein, und auch nur dann, wenn man sicher ist, trotzdem den für das Revier und den gesunden Bestand sinnvollen und erforderlichen Abschuss erfüllen zu können. Problemlos ist das besonders in solchen Revieren, in denen ich angepasste Wildbestände habe.
Und selektiv kann und sollte man jagen, wenn man den unmittelbaren Vergleich hat. Will sagen: Wenn ich zwei oder mehrere Stücke zusammen sehe, schieße ich eben zunächst das offensichtlich schwächere, kleinste. Aber nicht, weil ich vordergründig „schlechten Genbestand der Wildbahn entnehmen will“, wie´s oft so hochtrabend heißt. Denn das viel stärkere Stück daneben ist oft genug Bruder oder Schwester aus dem Vorjahr, und Geschwister haben bekanntlich eine bis zu 100 % identische genetische Ausstattung. Sondern weil
- ich verhindern will, dass das Stück in ein paar Monaten im Gebüsch verludert oder auf der Straße stirbt und damit meiner Backröhre entgeht und
- weil auch ein schwaches Stück im Bestand und Revier für sozialen Stress sorgt.
Wen´s beruhigt, der kann ja hinterher eine Genanalyse vom geschossenen Stück vornehmen lassen. Man kann´s aber auch einfach mit Genuss und Freude essen.
Um es noch einmal klar zu sagen: Selektion im obigen Sinne, also im unmittelbaren Vergleich, wenn man das dann überhaupt so überhöht nennen will, ist völlig in Ordnung. Selektion als Synonym zum vielfach gequälten Begriff „Hege“ aber wird da regelmäßig zum massiven Problem, wo darunter eigentlich nur Folgendes verstanden wird: Nicht schießen, morgen könnte ja noch was Schwächeres, Mickerigeres kommen. Man hat schon mal den Eindruck, dass manche Beständer am liebsten erst mal alle Rehe im Revier in eine Reihe stellen würden, um dann das schwächste zu füsilieren. Streng weidgerecht.
Viele Jungjäger trauen sich einfach auch deshalb nicht zu schießen, weil so mancher Jagdherr (welch ein Begriff!) völlig abstruse Abschuss- Vorgaben setzt. Die meisten von uns kennen die: „Keinen Bock über lauscherhoch auf!“; „Gabler? Zukunftsbock, unbedingt schonen!“; „Schmalreh? Nur, wenn erkennbar sowieso kurz vor dem Exitus; schließlich sind das die Mütter unser künftigen Böcke!“; „Ricken? Wohl wahnsinnig!“; „Bockkitze sind tabu.“ Und wehe, es wird gegen diese hehren Grundsätze der Weidgerechtigkeit verstoßen: Öffentliche Anklage mit mindestens einjährigem Liebesentzug mitsamt Jagdverbot ist die Folge, am Jägerstammtisch kann man sich nicht mehr sehen lassen.
Genau das ist dann auch der Grund dafür, dass am Ende der Jagdzeit mit schöner Regelmäßigkeit in vielen Revieren Hektik aufkommt. Man rennt dem Abschuss hinterher. Natürlich wird er nicht erfüllt, und natürlich wird er aber dann als erfüllt gemeldet. Dass das verbreitete Praxis ist, lässt ja, logisch, nur einen Schluss zu: Man weiß, man kann´s nicht, aber das würde man nie zugeben! Die Jagdmethoden, genau genommen die oft einzig praktizierte Methode, nämlich der Daueransitz auf immer den gleichen Hochsitzen, tun ein Übriges. Eine gezielte Drückjagd auf Rehwild z. B. gilt bei vielen Zunftgenossen wie in uralten Zeiten als unweidmännisch, man rümpft indigniert die Nase. Wenn´s reicht.
.
„Im Einklang mit der Natur“ – mein persönliches, ganz spezielles Reiz- Zitat
Wer kennt es nicht, das Totschlag- Zitat der Jagdgegner, der „Naturschützer“, der zivilisationsverdrossenen Selbstverachter? Man sehnt sich nach der Natur, nach Ursprünglichkeit. Aber natürlich von der bequemen Couch aus, mit Zentralheizung, dem Doktor und Aldi um die Ecke. Die Klage: Alles lebt im „Einklang mit der Natur“, vor allem natürlich unsere Tiere, aber auch Angehörige ursprünglicher Völker, Nomaden, Jäger und Sammler. Nur der moderne Mensch, dieser Kretin, tut das nicht, vor allem aber der moderne Jagdmensch nicht. Der ist schlicht ein Ausbund an Tücke, an Falschheit, lebt perverse, „neandertaloide“ Triebe aus. Die man gerade noch bei den Naturvölkern bewundert hat, versteht sich. Und, völlig verrückt, obwohl gerade die sofort und auf der Stelle mit unserem Couch- Naturschützer tauschen würden, eben wegen der Couch, der Zentralheizung, dem Doktor und dem Aldi um die Ecke. Na ja. Um manche abstrusen Weltbild- Kompositionen aufrechterhalten zu können, ist es oft nötig, den Begriff „Konsequenz“ konsequent auszublenden.
Um es ganz klar zu sagen: Die Natur hat mit auch mit unserer „modernen“ Jagd null Probleme. Nothing. Rien. Nic. Mit uns Jagdmenschen sowieso nicht. Sie betrachtet uns als Teil des Ganzen, als Umweltfaktor, wenn wir so wollen, als einen Teil der völlig natürlichen Jägergemeinde. Von denen jagen einige mit Kraft, andere mit Ausdauer, einige mit einer Mischung aus Kraft, Ausdauer und Intelligenz, wieder andere mit Gift, einige mit Netzen und sonstigen Fallen. Manche, wie z. B. Schimpansen, aber auch einige Vogelarten, benutzen Werkzeuge. Wir Jagdmenschen nutzen unsere Intelligenz und die mit Hilfe dieser Intelligenz entwickelten Waffen und Geräte, jeder nach seinen Möglichkeiten und nach seinem Bedarf, egal ob Buschmann oder moderner Jäger. Und die Intelligenz haben wir schließlich von der Natur, wie kann das dann unnatürlich sein?
Aber wir sollten sie nicht dazu missbrauchen, den grundsätzlichen Charakter der Jagd zu verändern, sie mit ideologischen Modeströmungen zu verhunzen, denn damit zerstören wir tatsächlich den Einklang mit der Natur. Abgesehen davon, dass das sowieso immer nur Zeiterscheinungen sind, die sich über kurz oder lang wieder verlieren: Wir nehmen uns damit nicht nur die Freude an der Jagd, sondern werden auch noch zu diesen verbissenen, humorlosen Typen, die Otto Normaljäger oft so auf die Fichte bringen: Zu Überjägern, mitsamt den bekannten Trophäenschauen, Bewertungsschemata und roten Punkten an „Fehlabschuss- Trophäen“. Der Jagdneid und das gegenseitige Hintereinanderherreden werden praktischerweise gleich mitgeliefert. Machen wir´s einfach so weit wie möglich Bruder Wolf, Cousin Luchs und Onkel Bär nach, nach guter alter, seit Jahrmillionen bewährter Regel der Kunst.
.
Grenzen der Theorie
Denn wenn wir den Faden weiter spinnen, stoßen wir sowieso an logische Grenzen. Angenommen, wir haben den Bestand tatsächlich auf die „Pionierphase“ (den Begriff hat meines Wissens Fred Kurt in „Das Reh in der Kulturlandschaft“ kreiert, und er ist Programm) herunterreguliert, was ja bekanntlich unser Auftrag ist. Dann sind schwache Stücke die unbedingte Ausnahme. Und dann? Stellen wir dann die Jagd ein, bis wieder genug schwache da sind, die man ja als „weidgerechter“ Jäger allein schießen darf? Natürlich nicht. Denn dann sind wir da, wo wir eigentlich hinwollten. Dann jagen wir nach dem einzig wahren Motiv, das Grund für die Jagd sein sollte: Nachhaltig und verantwortungsvoll zwar, den Zuwachs abschöpfend. U n d aus reiner Freude an der Beute, an der Jagd, am Draußensein, an der ganzen Melange von Wahnsinnsgefühlen, die mit ihr zusammenhängen.
Die Tatsache, dass Rehe bzw. Ricken, Rehgeißen auf mehr Raum und mehr Nahrungsangebot (die „Pionierphase“ eben!) tatsächlich damit reagieren, dass sie im Durchschnitt erstens mehr und zweitens mehr weibliche Kitze setzen, die entscheidenden Zuwachsträger also, wird uns bekannterweise, wenn´s denn gerade besser passt, als Argument gegen die Jagd entgegengehalten.
Tenor: Jagd ist kontraproduktiv. Sie regt die gesamte Tierwelt ja nur zu vermehrtem Zuwachs an.
Na ja. Darauf braucht ein logisch denkender, von ideologischen Zwängen befreiter Mensch eigentlich ernsthaft nicht einzugehen, denn nach der Logik wären wir unbedingt aufgefordert, Wolf, Luchs, Bär, Großkatzen und jeden weiteren Mitjäger auf der Stelle auszurotten, bevor unsere schöne Mutter Erde aufgrund des schieren jagdbedingten Zuwachses unter der eigenen Masse kollabiert und als Schwarzes Loch endet.
Für uns Jäger bedeutet das eigentlich nur: Wir müssen „am Jagen bleiben“, also weiter mehr schießen. Damit erhalten wir die Pionierphase, in diesem speziellen Fall beim Rehwild. Wir schießen mehr, wir schießen „qualitativ“ besseres, schwereres, gesunderes Wild. Was wollen wir mehr? Keine Angst: Das „mehr“, das wir schießen, fällt nicht vom Himmel. Es ist einfach das, was ansonsten elend in den Büschen verreckt. Und wir schießen natürlich jedes Jahr den einen oder anderen starken, vielleicht kapitalen Bock, mitsamt berechtigter, reiner Freude an der schönen Trophäe und den damit verbundenen Erinnerungen. Was man sich auch verdient hat, weil man sein Revier in Ordnung gehalten und sich dafür das ganze Jahr den Hintern aufgerissen hat. Nebenbei bemerkt, in Ordnung gehalten auch für die statistisch auf jeden Jäger entfallenden anderen 245 Bundesbürger, die keine Jäger sind, aber von einer intakten Umwelt, von gesundem Wild ebenfalls profitieren, und sei es nur aus reiner Freude an der Ästhetik.
.
Es geht – und wie!
Die schwedischen Jagdfreunde übrigens jagen genauso. Sie schießen ihre Rehe, wenn sie sie sehen, so lange, bis der vorgegebene Abschuss erfüllt ist. Meist völlig wahllos. Sogar das Brackieren von Rehen habe ich bei denen gelernt. Mit dem Stövare und der Flinte. Das klappte ganz erstaunlich gut! Und geschossen wird dabei das Stück, das der Hund eben gerade hoch macht. Der wiederum schert sich einen Teufel darum, wie schwer, wie gesund, wie alt oder sonst was das Stück ist. Für manchen deutschen „Heger“ ein untragbar skandalöses Verbrechen. Die Schweden sehen das aber sehr entspannt. Und haben sich mit dieser „unverantwortlichen Totschießerei“ (beim Brackieren, und nicht nur da, mit Schrot!) einen der besten, gesundesten Rehwildbestände Europas erhalten, mit Durchschnittsgewichten, von denen wir hier nur träumen können, und so kapitalen Böcken, dass jeder deutsche Jäger andachtsvoll die Luft anhält. 4)
.
Fazit – oder langer Rede kurzer Sinn
Wir Jäger können, wenn wir alles richtig machen, die Bestandsdichte regulieren. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Aber das reicht schon, völlig, denn exakt das ist die ökologische Begründung für die Jagd. Weil wir damit genau das tun, was Jagd und damit auch Menschenjagd allein erreichen kann, weshalb sie „erfunden“ wurde: Wir erhalten die Balance im System, zum Nutzen des Jägers (Beute!) und zur Gesunderhaltung des verbleibenden Bestands, der Flora, des gesamten Gefüges.
Was wir mit der Jagd nie erreichen können, auf jeden Fall nie unmittelbar, ist, einen (Reh-) Wildbestand genetisch „aufzuarten“, zu verbessern oder zu selektieren. Bei anderen Wildarten akzeptieren wir das klaglos. Oder hat das mal irgendjemand auch nur ansatzweise beim Schwarzwild versucht? Beim Niederwild? Bei Füchsen? Hören wir einfach auf mit dieser Vernebelung. Überlassen wir die Evolution, nichts anderes ist die genetische Fortschreibung, einfach wieder der Natur, meinetwegen dem lieben Gott; wir sollten endlich aufhören, den beiden ins Handwerk pfuschen zu wollen. Ganz nebenbei haben wir auch bei weitem nicht deren beider Zeit und Geduld, die dazu nötig wäre. Das muss man nur akzeptieren.
Denn die Kehrseite der Medaille „selektive Jagd“, ganz abgesehen davon, dass sie eh nicht funktioniert, ist schlicht und einfach, dass das, was wir tatsächlich können, nämlich die Kontrolle der Bestandsdichte, auch auf der Strecke bleibt.
Warum also machen wir uns das Leben selbst schwer? Einfach nur jagen gehen reicht doch. Völlig.
.
Kirchveischede, 10. Mai 2014
.
Manfred Nolting
Ein Jagdmensch
.
.
1) Das gibt es auch beim Menschen – speziell im und nach dem Weltkrieg I gab es auch bei uns diese Hungerkinder, und die Holländer haben bei Weltkrieg II- Kindern dieses Phänomen sogar wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen, und wer kennt nicht die Skandalfotos von Hungerkindern in Afrika. Deren Kinder wiederum kommen wieder „ganz nach der Art“, trotz der gehandicapten Eltern, ausreichende Ernährung im Kindes- und Entwicklungsalter natürlich vorausgesetzt. Gesichert und tausendfach belegt ist, dass Entwicklungsdefizite, die auf Mangel, vor allem Nahrungsmangel, sei es pränatal oder in der frühkindlichen Entwicklungsphase, zurückzuführen sind, vom Individuum in der späteren Entwicklung nie wieder ausgeglichen oder aufgeholt werden können, auch bei üppigsten späteren Lebensverhältnissen nicht.
.
2) Herzog Albrecht von Bayern und seine Frau Jenke, die ich post mortem für die mit profundesten Kenner und Praktiker unseres Rehwildes halte, schrieben dazu in ihrem lesenswerten Buch „Über Rehe in einem steirischen Jagdrevier“ (BLV- Verlag, 1977) über die Jährlingsbejagung wie folgt:
Thema Knopfböcke:
Das bis zum Überdruss durchdiskutierte und abgedroschene sogenannte „Knopfbockproblem“ ist überhaupt kein Problem! Es ist lediglich eine Frage der Jugendentwicklung. Kommen die Bockkitze, im Wachstum zurückgeblieben, in den Winter, so werden daraus Knopfböcke; sind sie aber bis zum Winteranfang entsprechend herangewachsen, so gibt es keine Knopfböcke. Eine vererbliche „Knopfbockanlage“ dürfte nur höchst selten vorkommen. Daher ist diesem „Problem“ mit Wahlabschuss von der Bockseite her nicht beizukommen.
und:
Thema Jährlingsabschuss:
Was soll man aber jetzt abschießen? Vor allem genug! Wenn man sich einmal darüber Rechenschaft gibt, wie wenige Jährlinge man zum Nachrücken braucht und wieviele vorhanden sind, dann sieht man, dass man nicht heikel zu sein braucht, und dass es nicht langt, wenn man nur die schlechten abschießt, sondern dass man besser hinkommt, wenn man nur die ganz guten nicht schießt! ……… Unter den „allerbesten verstehen wir aber in erster Linie die besten in Körper und Gesundheitszustand. Haben sie dann noch dazu gut auf, ist es umso besser. Aber schon beim Jahrling sollte man sich angewöhnen, vom Geweih wegzuschauen und den Körper- und Gesundheitszustand als erstes zu sehen und erst danach auf das zu schauen, was der Rehbock auf dem Kopf hat. Nichts ist so hinderlich für das Ansprechen eines Rehbocks wie der Magnetismus, den diese verdammten „Stangeln“ auf unsere Augen ausüben!
.
3) Ganz nebenbei: Langsam kann so ein Stück schon aus dem ganz einfachen Grund sein, dass es sich am Vortag ein Bein vertreten hat. So was ist normalerweise in einer Woche wieder ausgeheilt, dann ist man wieder wie neu. Wenn man als Ren aber Pech hat, kommt genau in dieser Woche der Wolf dazwischen. Selektion? Sors mala, nihil aliud. Oder, auf Deutsch: Einfach nur dumm gelaufen.
.
4) In den letzten Jahren gibt es auch in Schweden vermehrt Jäger, die Wert auf eine gute Trophäe legen. Warum auch nicht? Als ich vor 25 Jahren das erste Mal in Schweden jagte, habe ich bei einigen Jagdfreunden wirklich kapitale Bockgehörne in irgendeiner Schuppenecke im Gerümpel gefunden oder achtlos an die Außenwand der Hütte genagelt. Die meisten, haben sie mir erzählt, hätten sie allerdings weggeworfen oder gleich im Wald gelassen. Die konnte man ja nicht essen, warum dann mitschleppen?